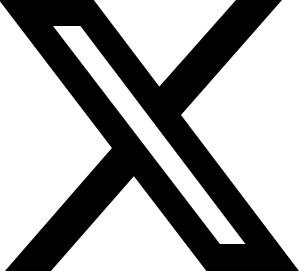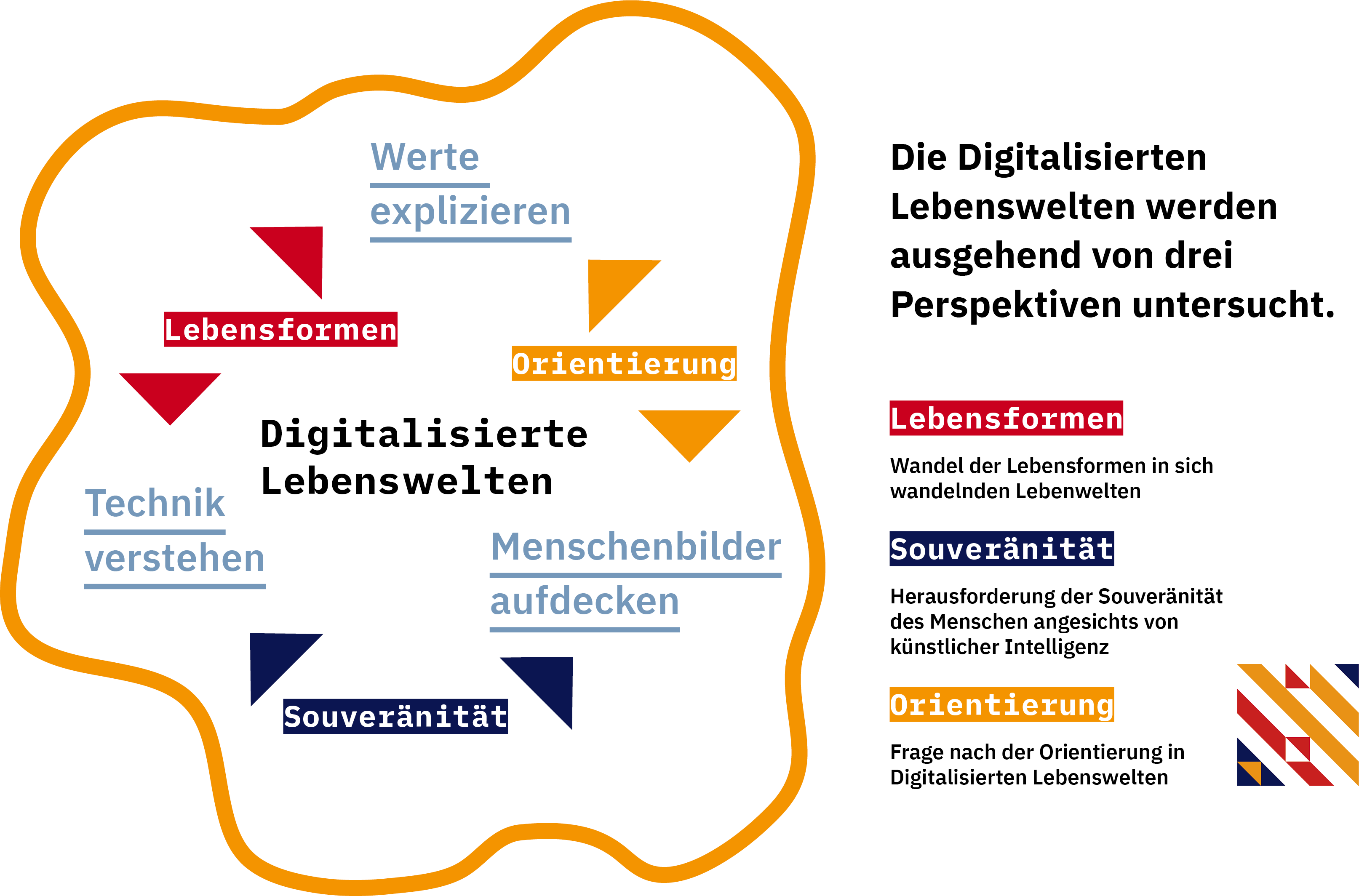Aktuell
- „Bitte intervenieren Sie!“ – Impluspapier zu Kollaborativen Interventionen veröffentlicht
- Blogbeitrag: Inklusive Partizipation in der Forschung – Einblicke aus dem Projekt INPARTIm Projekt INPART der Hochschule Bremen geht es um die… Blogbeitrag: Inklusive Partizipation in der Forschung – Einblicke aus dem Projekt INPART weiterlesen
- UWIGO zu Gast im Klimahaus BremerhavenDie Forschenden rund um das Team von Prof. Dr. Hannah… UWIGO zu Gast im Klimahaus Bremerhaven weiterlesen